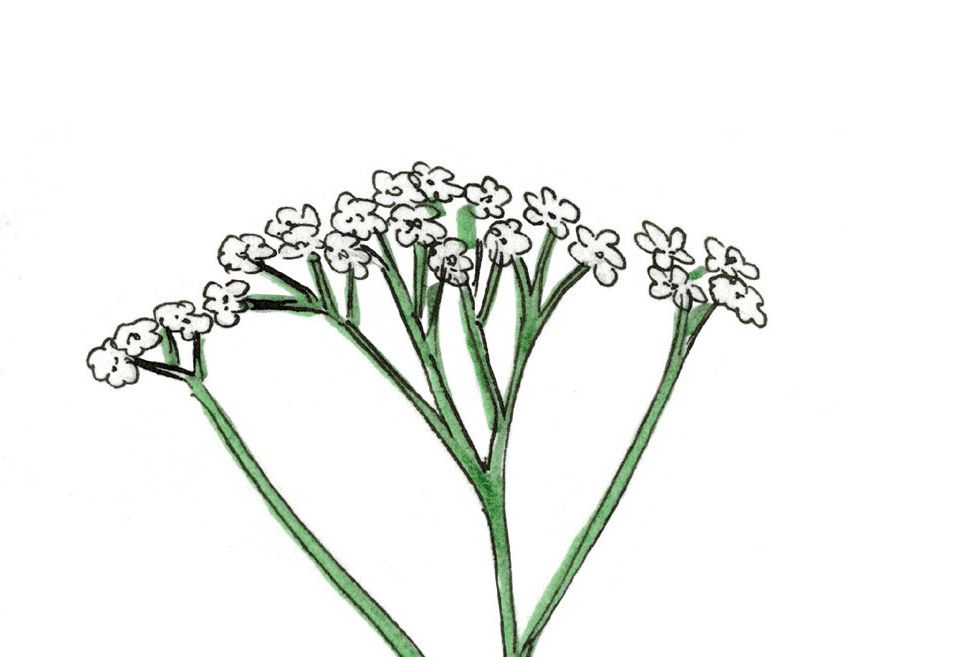Flechten: Annäherung an die Wuchsformen der Mischwesen
Seit Jahrtausenden betrachten Menschen Flechten, berühren sie, riechen daran, kosten sie. Sie zermahlen sie zu Tee, färben Stoffe mit ihnen, unterscheiden einzelne Arten und beobachten, wo diese vorkommen und wo nicht. Natürlich wissen wir nicht sicher, was unsere Vorfahren über Flechten dachten, aber nachgedacht haben sie zweifellos über sie. Sind es Pflanzen? Algen, die sich an das Leben an Land angepasst haben? Merkwürdige Pilze?
Heute wissen wir, dass Flechten eine Symbiose aus zwei oder mehr Organismen darstellen. Die allermeisten bestehen aus einem Pilz, dem Mykobionten, in den winzige, Fotosynthese betreibende Zellen von Algen und/oder Cyanobakterien eingebettet sind, die Fotobionten. Ein ganzer Wissenschaftszweig, die Lichenologie oder Flechtenkunde, widmet sich heute ihrer Erforschung, und ihre Symbionten sowie zahllosen Formen und Strukturen werden mit einer eigenen Terminologie beschrieben. Unser Wissen über Flechten ist also mühsam erworben.
In «Flechten» bieten Robert Lücking und Toby Spribille einen Einstieg für all jene, die mehr über diese faszinierenden Lebensformen erfahren und in ihre Welt eintauchen möchten.
In diesem Beitrag schauen wir uns Aspekte der Flechtenarchitektur genauer an und fragen uns: Was haben die Pilze dabei für eine Aufgabe und was haben Flechten mit Pflanzen gemeinsam?
Flechten sind die einzigen Pilzsymbiosen, in denen sich die Form im Zusammenhang mit Fotosynthese entwickelt hat. Keiner der Symbiosepartner vermag diese Form alleine hervorzubringen; die Architektur einer jeden Flechte kommt nur dann zustande, wenn der Pilz mit seinem Fotosynthesepartner zusammen ist. Wir beginnen erst allmählich zu verstehen, weshalb es genau die Formen gibt, die wir heute sehen, doch höchstwahrscheinlich stellt jede dreidimensionale Flechtenstruktur einen optimalen Kompromiss zwischen der besten Lichtausbeute einerseits und optimaler Lagerdurchlüftung andererseits dar.
Pilze im Dienst der Fotosynthese – Wuchsform gesteuert durch Symbiose
Bei den meisten Flechten besteht der «Körper» oder das Lager vor allem aus dem Pilzpartner, er bildet sozusagen das Grundgerüst für die Gesamtarchitektur. Algen oder Cyanobakterien befinden sich in einer Schicht im Inneren. Ausnahmen stellen fadenförmige oder gallertige Flechten dar, bei denen die Form des Lagers offenbar vom fotosynthetisierenden Partner bestimmt wird.
Die vielzelligen Strukturen, die die Flechtensymbionten herstellen, sind nicht mit denen von Tieren zu vergleichen. Sie füllen den Raum nicht über Zellteilungen, vielmehr lagern sich die einzelnen Pilzhyphen zu einem Geflecht zusammen, etwa vergleichbar einem Gartenstuhl aus Rattan. Wie bei einem solchen Gartenstuhl hängt die spezifische Form davon ab, wie und in welchen Winkeln die fadenförmigen Pilzhyphen aneinanderhaften. Doch der Pilz tut das nie ohne einen Fotosynthesepartner, und ohne einen solchen Partner wurde auch noch nie eine sexuelle Vermehrung von Flechtenpilzen beobachtet.
Wie Algen oder Cyanobakterien bei einem Pilz diese Form der Selbstorganisation durch Verkleben von Zellen auslösen, ist immer noch weitgehend unverstanden. Möglicherweise verhilft der fotosynthetisierende Partner dem Pilz zu einem besseren Reproduktionserfolg, und das umso mehr, je besser es als Team klappt. Vielleicht ist das der Schlüssel zu einem uralten Kreislauf der natürlichen Selektion, der uns die heutige Flechtenvielfalt beschert hat.
Im Folgenden schauen wir uns einge Wuchsarten genauer an:
Ein Spiegel der Pflanzenmorphologie?
Die meisten Pflanzen folgen einem einfachen Grundbauplan: Wurzel, Stängel, Blätter. Flechten dagegen haben keinen einheitlichen Bauplan und nehmen eine Vielzahl unterscheidlicher Wuchsformen an.
Die grundsätzliche Wuchsform einer Flechte lässt sich anhand einiger weniger einfacher Fragen ermitteln:
- Ist der Wuchs zwei- oder dreidimensional?
- Ist die Flechte (fest oder lose) auf einer Oberfläche befestigt, oder hat sie nur einen einzigen Anhaftungspunkt?
- Ragen vertikale Strukturen von einem horizontalen Lager, das unterschiedlich gestaltet sein kann, nach oben?
- Ist der Pilz das Dominante Element oder wird die Wuchsform vom Fotobionten bestimmt?
- Quillt die Flechte, wenn sie befeuchtet wird?
Daraus ergeben sich folgende Wuchsformen:
Robert%20Lcking.webp#)
Robert%20Lcking.webp#)
Robert%20Lcking.webp#)
Robert%20Lcking.webp#)
Robert%20Lcking.webp#)
Robert%20Lcking.webp#)
Robert%20Lcking.webp#)
Robert%20Lcking.webp#)
Flechten und Pflanzen weisen unabhängig voneinander bemerkenswert ähnliche Lösungen für schwierige Umweltbedingungen auf (Konvergenz), etwa die Optimierung der Fotosynthese. Ein Schnitt durch eine in Schichten aufgebaute Flechte ähnelt einem Schnitt durch ein Blatt, obwohl es in einigen Details auch beträchtliche Unterschiede gibt. Sonst gingen Flechten und Pflanzen in vielerlei Hinsicht unerschiedliche Wege. Flechten nehmen Wasser und Nährstoffe normalerweise über ihre gesamte Oberfläche auf, während Gefäßpflanzen (Tracheophyten), darunter Samenpflanzen, Farne und farnähnliche Pflanzen, Wurzeln und spezialisierte Gefäße für den Wassertransport nutzen (obwohl über die Blattoberflächen ebenfalls in gewissem Umfang Wasser und Nährstoffe aufgenommen und abgegeben werden können). Außerdem sind Flechten tolerant gegenüber Austrocknung auf Zellebene. Das können nur wenige Gefäßpflanzen, zum Beispiel die sogenannten Auferstehungspflanzen aus der Gattung Selaginella (Moosfarne), die in vielen Wüstenregionen vorkommen.
Homologien mit Pilzen?
Die Ähnlichkeiten zwischen Flechten und Pflanzen beruhen auf Analogien, das heißt, sie verdanken die ähnlich aussehenden Strukturen nicht einem gemeinsamen Vorfahren. Beim Vergleich von Flechten und anderen Pilzen dagegen beruhen die Ähnlichkeiten auf Homologien. Der größte Teil der Biomasse von Flechten sind miteinander verwobene Pilzhyphen, die gleiche Art mikroskopisch kleiner Zellfäden, aus denen auch die Groß- und die Schimmelpilze bestehen. Bei nicht lichenisierten Pilzen – Großpilzen, Porlingen und Becherlingen – dienen die komplex aufgebauten Strukturen der Reproduktion. Doch wie genau Flechten zu ihrer komplexen Architektur kommen, ist immer noch nicht wirklich verstanden, weshalb dieses Phänomen manchmal als der «Heilige Gral der Pflanzen-Mikroben-Interaktion» bezeichnet wird.
Bei Großpilzen werden Gene, die mit der sexuellen Fortpflanzung zu tun haben, in den frühen Stadien der Fruchtkörperbildung hochgeregelt. Einer Theorie zufolge leitet sich das Flechtenlager ebenfalls von modifizierten Fruchtkörpern her. In den 1960er-Jahren wies die französische Flechtenforscherin Marie-Agnès Letrouit-Galinou die auffallende Ähnlichkeit zwischen den gebündelten Pilzhyphen in Cladonia-Podetien und den gebündelten Hyphen in nicht lichenisierten Pilzen wie Heyderia nach, die ihre Sporen am oberen Ende von kleinen Keulchen bilden. Erst vor Kurzem wurde entdeckt, dass manche Pilze aus der Keulchenverwandtschaft wie die Erdzunge (Geoglossum) und manche Flechtenpilze einen gemeinsamen Vorfahren haben und die Aufspaltung der Linien noch nicht allzu lange zurückliegt. Die Ergebnisse weiterer Studien werden sehnsüchtig erwartet.
Alle Fotos stammen von Robert Lücking.
Robert Lücking ist Leiter der Abteilung «Evolution und Biodiversität» am Botanischen Garten Berlin. Er ist ein weltweit führender Mykologe und Lichenologe, mit über 500 Publikationen in Fachzeitschriften und mehr als 1000 neu entdeckten Arten.
Toby Spribille ist Inhaber der kanadischen Forschungsprofessur für Symbiose und Privatdozent für Biologische Wissenschaften an der University of Alberta, Edmonton.
Auflösung Instagram- und Facebook-Rätsel:
Robert%20Lcking.webp#)
Auf dem Bild handelt es sich tatsächlich um eine Flechte:
An Ramalina celastri, einer Astflechte, wird der Stoffwechsel der Flechten im trockenen und feuchten Zustand erforscht sowie die Rolle, die Zuckeralkohole dabei spielen.