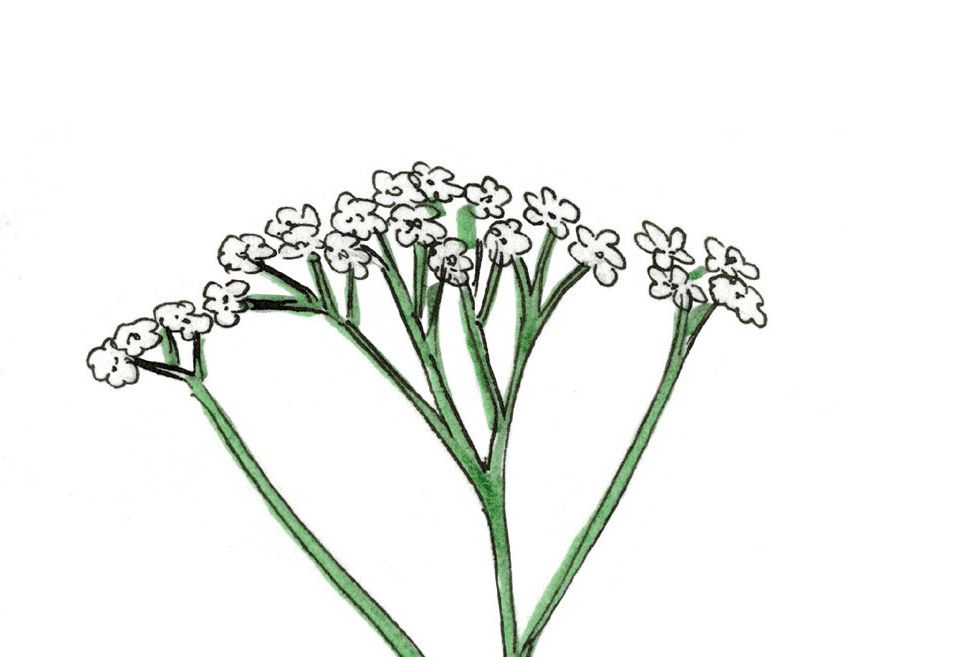Luft: Das Elixier des Lebens
Nehmen Sie sich einmal bewusst Zeit und atmen Sie ein ... und wieder aus ... und wieder ein ... und wieder aus ... Wiederholen Sie das Ganze einige Male und lenken Sie dabei Ihre Gedanken auf sich und den eigenen Atem.
Und? Fühlt sich das nicht unglaublich entspannend und gut an?
Luft besteht aus 78 Prozent Stickstoff, 21 Prozent Sauerstoff, 0,96 Prozent Argon und 0,4 Prozent anderen Gasen und Elementen. Luft geht uns alle etwas an. Wir brauchen sie, sie ist unabdingbar für unsere Existenz. Obwohl wir sie nicht sehen, lassen wir sie keineswegs unberührt. Tatsächlich verbraucht jeder Mensch rund 360 Liter Luft pro Stunde. Wir müssen unentwegt Luft konsumieren. Und auch wenn wir nicht sehr oft darüber nachdenken mögen, verdient die Luft daher unsere Aufmerksamkeit.
Schenken wir ihr diese, indem wir zusammen einige ausgewählte Atemzüge aus Peter Adeys literarischer «Luft» atmen.
BREATHE IN, BREATHE OUT
Jeder Atemzug enthält etwa einen halben Liter Luft. Wir ziehen sie in unseren Körper und stoßen sie wieder aus, tränken unser Blut mit dem Sauerstoff aus der Luft und geben Luft als Abgas wieder ab, in Form von Atem, Rülpsern, Pupsern oder Sprache. Das Einziehen von Luft – die Einatmung – erweitert die Brusthöhle durch die Bewegung des Zwerchfells, das sich zusammenziehen und ausdehnen kann. Diese Zunahme des Brustvolumens erzeugt das negative Druckgefälle, das Luft in die Lunge strömen lässt, wo sie dieser gibt, was sie braucht. Am meisten brauchen wir jedoch die 21 Prozent Sauerstoff, der von der Lunge in den Blutstrom abgegeben wird. Was herauskommt, also die Luft, die den Körper verlässt, ist anders. Der Körper hat der Luft den Sauerstoff entzogen und gibt sie mit Kohlendioxid, Wasserdampf und etwas Wärme angereichert wieder ab.
Wir könnten also sagen, dass unsere Körper im Grund wandelnde Luftfilter sind, vor allem für Pflanzen, die das Kohlendioxid aufnehmen, das wir abgeben (deshalb ist es gut für Pflanzen, wenn wir mit ihnen sprechen), aber wir tun das nicht alle im selben Ausmaß. Läuferinnen und Läufer beispielsweise entwickeln eine große Lungenkapazität und bewegen beim Ein- und Ausatmen große Luftmengen. Dies lässt sich auf unterschiedliche Arten messen, aber die wohl häufigste ist als «VO₂max» oder «maximale Sauerstoffaufnahme» bekannt (wobei V für Volumen steht und O₂ für Sauerstoff). Der Durchschnittswert für Männer und Frauen liegt zwischen 27 und 40 Milliliter Sauerstoff je Kilogramm Körpergewicht pro Minute. Die Kapazität von Sportlern wie Usain Bolt wird zwischen 80 und 90 ml je Kilo pro Minute angegeben. Wenn wir uns nun erinnern, dass Sauerstoff etwa 20 Prozent der Luft ausmacht, ist das eine ganze Menge Luft, die pro Minute durch die Lunge eines Menschen wandert. Selbst für einen durchschnittlichen Menschen liegen die Schätzungen der Luftmenge, die er im Laufe seines Lebens atmet, bei etwa 265 Millionen Litern aufwärts.
Die Atmung ist etwas, das viele Lebewesen auf dem Planeten, nicht nur Menschen, zum Überleben brauchen. Alle Säugetiere atmen Luft; selbst diejenigen, die im Meer leben, müssen auftauchen, um Luft ein- und auszuatmen. Insekten atmen auch, aber anders. Anstelle fleischiger Lungenflügel atmen Insekten durch ihr Exoskelett über sogenannte Stigmen, die sich öffnen und schließen, um Luft in die Tracheen und damit beinahe direkt ins Blut zu leiten. Dieser Atemvorgang sorgt bei einem Großteil des organischen Lebens dafür, dass die Zellen funktionieren, wachsen und sich vermehren. Im Zentrum der Arbeit unserer Zellen steht die sogenannte Zellatmung oder aerobe Atmung – ein Prozess, durch den die Gase in der Luft, also der Sauerstoff, über eine Art der Verbrennung nutzbar gemacht werden. Die Zellatmung ist im Wesentlichen eine chemische Reaktion, in der die Energie erzeugt wird, die die Zellen brauchen. Pflanzen tun das über die Fotosynthese und atmen dabei auf eine ganz andere Weise Luft als Tiere. [...]

DIE GEBURT DER LUFT
Woher kam unsere Luft und wie hat sie sich verändert?
Heute besteht unsere Atmosphäre aus einer Reihe häufiger Gase wie Methan, Ammoniak, flüchtigen Aminen, organischen Säuren, Schwefelwasserstoff, Stickstoff, Lachgas und anderen. Aber so war es nicht immer. Man nimmt an, dass unsere frühe Atmosphäre vor allem aus Wasserstoff und Helium bestand, von denen sich ein Teil ins Weltall verflüchtigte. Später, als Schwerkraft und Magnetfeld der Erde stärker wurden, hielten sie schwerere Gase fest. Starke vulkanische Aktivitäten führten dazu, dass durch das sogenannte «Ausgasen» ein bedeutender Anteil Kohlendioxid, Methan und Salzsäure dazukam. Ein großer Teil des Kohlendioxids wurde in dieser Zeit in Karbonatgestein eingeschlossen und löste sich in den Meeren, die kühlenden Wasserdampf bildeten. Und doch war der wohl größte Faktor, der unsere Luft beeinflusste, das Leben.
Vor rund 3,5 Milliarden Jahren, als die ersten organischen Bakterien und frühen organischen Lebensformen auf der Erde erschienen, veränderte sich auch die Atmosphäre. Bemerkenswert an dieser Zeit ist, dass Sauerstoff damals noch nicht in der Luft war, sondern erst eingebracht wurde. Organismen begannen, die Zirkulation und Kreisläufe von Gasen so zu regulieren, dass sie damit die Luft oxidierten und damit bessere Bedingungen für aerobe Lebensformen schufen, also für Leben, das von der Atmung abhängig ist. [...]
Wenn die Geburt der Luft untrennbar mit der Geburt des Lebens auf der Erde verknüpft ist, dann ist diese Genese möglich, weil Luft den Transport und die Verteilung von Material wie Kohlenstoff ins Meer oder Sauerstoff in die Atmosphäre ermöglicht. Trotz seiner substanzlosen Erscheinung kann die Luft im Laufe der Zeit große Mengen Materialien bewegen. Sehen wir uns kurz im Karbon um, einer Periode vor einigen Hundert Millionen Jahren, als die großen Kohlenstoffvorräte der Erde durch das schnelle Wachstum von Sümpfen und Wäldern aus rindentragenden Bäumen entstanden, die sich schließlich in dicken Kohlesedimentschichten ablagerten. Durch die Messung von Kohlenstoffisotopen in Gesteinen und in Fossilien eingeschlossenen Gasblasen, auch «fossile Luft» genannt, ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft inzwischen einig, dass dieses starke Wachstum durch eine sogenannte «Sauerstoffspitze» verursacht wurde. Einem traditionelleren Erklärungsansatz zufolge ging zwar die klimatische Landschaft gemäßigter Sümpfe und Wälder aus langsamen tektonischen Veränderungen hervor, doch die Wissenschaft hielt dagegen, dass die Pflanzen selbst diese Veränderung herbeiführten.
Die massive Sauerstoffspitze (bis zu 35 Prozent der Atmosphäre gegenüber der geringeren Konzentration heute) führte zu Riesenwuchs bei Amphibien und Insekten, vor allem in Form riesiger Libellen, die mehr als fünfmal so lang und deren Thorax doppelt so breit war wie die der größten heutigen Libellen und deren Flügelspannweite bis zu 70 Zentimeter betragen haben soll. Doch was verursachte die Spitze?
Mehreren Theorien zufolge hatten sich viele der Bakterien und Pilze, die tote Pflanzenmaterialien zersetzten, noch nicht so weit entwickelt, dass sie ein damals neues Molekül namens Lignin zerlegen konnten. Dieses Molekül verstärkte die Pflanzen und Bäume strukturell und ermöglichte ihnen, höher zu wachsen und eine deutlich dickere Rinde auszubilden. Die Bäume im Karbon enthielten viel Lignin, und die Unfähigkeit der Bakterien, die Bäume zu verdauen, führte dazu, dass der Kohlenstoff der Bäume unter den Sümpfen begraben wurde. Er gelangte nicht wieder in die Atmosphäre, sondern lag in der Erde eingeschlossen, bis er während der industriellen Revolution als Brennstoff wieder ausgegraben wurde. Obwohl es nicht so einfach ist, eine Korrelation zwischen höherem Sauerstoffgehalt in der Luft und der Entwicklung großer Säugetiere und Insekten herzustellen – da viele Insekten diesen Riesenwuchs nicht zeigten –, schrieb der Evolutionsbiologe und Sozialist J. B. S. Haldane 1928 in seinem Aufsatz On Being the Right Size: «Hätten die Insekten eine Möglichkeit gefunden, die Luft aktiv durch ihre Gewebe zu transportieren, statt sie nur einströmen zu lassen, hätten sie so groß wie Hummer werden können.» Aber es war nicht der Umstand, dass Insekten Sauerstoff durch ihre Gewebe transportierten, der sie größer machte, sondern der höhere Sauerstoffgehalt. Er ermöglichte einigen Insekten, im Verhältnis zu ihrem Tracheensystem größer zu werden, weil sie sich weniger anstrengen mussten.
Wichtig ist hier für uns, dass die Luft und was ihr entnommen und zurückgegeben wurde – nämlich Kohlenstoff durch die Fotosynthese der Pflanzen und Sauerstoff durch die Pflanzenatmung –, unglaublich wichtig für die Entstehung der Atmosphäre waren und Jahrmillionen später auch für die Gesellschaften, die diesen Kohlenstoff nutzten.
MEERESLUFT
In Jane Austens Anne Elliot (1817) machen Henrietta und Anne einen Abstecher zum «Cobb», einer damals häufig genutzten Hafenmole in Lyme Regis an der Südküste Englands, wo man die erfrischende Meeresbrise genießen konnte. Henrietta ist überzeugt, dass «Seeluft immer guttut», von ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen. Sie bringe den Körper so selbstverständlich wieder zu Kräften, dass sie besser wirkte als «sämtliche Arzneien» auf der Welt. [...]
Die viktorianischen Kurorte Brighton, Scarborough und Blackpool lockten die Schreibenden des 19. Jahrhunderts mit den stärkenden Eigenschaften der salzigen Seeluft. [...] Als Gesundheitsoasen boten diese Orte auch eine Gelegenheit zur Reflexion und zur Verjüngung.
In Cromer an der Nordküste von Norfolk will Elizabeth Gaskells Margaret Hale in Margarethe (1855) nach dem Tod ihrer Eltern und des Familienfreundes ihre körperliche Kraft wiedererlangen. Wendy Parkins erkennt hier eine aufkommende autonome und unabhängige Mobilität von Frauen, die den Ausbau der viktorianischen Eisenbahnlinien bis in die Seebäder nutzten, in die sie die gute Luft zog. Margaret, auf tragische Weise ihres Vaters und ihrer Mutter beraubt, fährt nach Cromer. Dort am Meer ist sie recht unbeweglich. Die Seeluft, ihre Brise und andere Figuren bewegen sich um sie herum. Margaret ist dort, um ihren Geist ebenso zu kurieren wie ihren Körper. Doch sie gibt sich nicht passiv der Luft hin. Vom Wind gestählt, nimmt sie nach ihrer Rückkehr in die Stadt ihr Leben in «ihre eigenen Hände». [...]
Auch heute noch wird der Besuch am Meer und das Verweilen an der frischen und gesunden Meeresluft auch von Ärzt:innen empfohlen.
LUFTARCHITEKTUR
«Außerhalb von Tucon in Arizona, mitten in der Wüste, eine geodätische Konstruktion aus Glas und Metall, die alle Klimazonen des Planeten im Miniaturformat enthält, wo acht Menschen (vier Männer und vier Frauen natürlich) zwei Jahre lang absolut autark und in einem geschlossenen Kreislauf leben werden – jedenfalls ist das der Plan.»
So beschrieb der Philosoph Jean Baudrillard Biosphere 2, das Experiment mit einer «Miniaturerde», finanziert von dem texanischen Milliardär Ed P. Bass. Begonnen wurde das Projekt viel früher, schon 1983, vom Institute of Ecotechnics mit Sitz in Santa Fe in New Mexico. Bass hatte eine gemeinsame Finanzierung durch seine Wagniskapitalgesellschaft und das Institut vorgeschlagen; das Unternehmen nannte sich «Space Biosphere Ventures».
Für Baudrillard drückt Biosphere 2 einen endemischen Katastrophismus in der US-Kultur aus. Der echte Planet wird als «verloren eingeschätzt» und zugunsten eines perfektionierten, isolierten und gefilterten Raums „geopfert“, in dem es keine Raubtiere, keine Krankheiten, keine Kontaminierungen jeglicher Art gibt. Die Erde bringt eine neue, perfektionierte Welt hervor, mit einer perfekten Atmosphäre, perfekter Luft, einen «klimatisierten Klon», der Raum ist «künstlich» immunisiert und seine Luft gereinigt. Keine Keime, Mikroben, nichts Fremdes; die Luft – alles – wird aufbereitet. Unter dem glitzernden Äußeren der Halbkugel liegt eine verborgene Innenarchitektur, die die Klimata der Kuppel aufrechterhält. Ein komplexes System aus Trocknern, Pumpen, Kammern und Reglern hält die Luft in Zirkulation, die Organismen am Leben und das Klima konstant.

Die geodätische Form des Bioms wird vielleicht nachvollziehbarer, wenn wir darin die «Kuppelkultur» oder sogar Bunkerkultur des amerikanischen Futuristen Buckminster Fuller erkennen. In seinem «totalen Denken» und seiner «vorausschauenden Planungswissenschaft», die in seiner heute berühmten geodätischen Kuppel umgesetzt wurden, ging es Fuller um die Organisation der eigenen Umwelt für die optimale Zuteilung von Ressourcen. [...]
Jüngere Luftarchitektur war 2002 am Neuenburgersee in der Schweiz zu sehen. Das Blur Building, auch die Wolke genannt, ist vielleicht ein gutes Beispiel für die «Luftarchitektur», da das Gebäude im Wesentlichen aus einer Wolke bestand, die ein Stahlskelett aus Laufbühnen und Technologie verbarg und dabei an die kurzlebigen Wolken-Tarntechniken erinnerte, die im Zweiten Weltkrieg getestet wurden. Dank 31 500 Nebeldüsen entstand auf dem See über der Wasserfläche eine Form mit variablen Abmessungen, etwa 90 Meter breit, 60 Meter lang und 20 Meter hoch. Das Gebäude änderte ständig Form und Größe, da der Nebel die Außengrenzen darstellt. Weil es jedoch aus Luft und Wasser bestand, war das Material des Gebäudes sein ärgster Feind, weil es so empfindlich auf Wind und seine Geschwindigkeit und Richtung, auf Feuchtigkeit, auf kleine klimatische Veränderungen reagierte.
Norbert%20Aepli,%20SchweizWikimedia%20Commons%20(CC-BY-2.5).webp#)
Andere Designs nahmen die Luft an die kürzere, wenn auch transparentere Leine. Im Bereich des aufblasbaren Designs und der pneumatischen Architektur begann etwa die Möbelfirma Zanotta 1968 mit der Herstellung des Blow Chair aus PVC-Folien, die mithilfe des Hochfrequenzschweißverfahrens miteinander verbunden wurden. Der von Jonathan De Pas, Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi und Carla Scolari entworfene aufblasbare Sessel entfachte eine allgemeine Begeisterung für aufblasbare Haushalts- und Freizeitobjekte. 1970 reichte das Designkollektiv auch ein Modell einer aufblasbaren Konstruktion für den italienischen Pavillon auf der Weltausstellung in Osaka ein.
Einerseits dienten einige Prinzipien der atmosphärischen Isolierung also als Inspiration für originelle, experimentelle Designs, die ihrerseits sehr interessante und wichtige nachhaltige Experimente anstießen, etwa Tim Smits Eden Project in Cornwall, das 2001 eröffnet wurde. [...]
JonWikimedia%20Commons%20(CC-BY-2.0).webp#)
Begeben wir uns zurück zur Biosphäre 2, wird auch hier deutlich, dass selbst die Luftisolierung unvollkommen ist, weil etwas fehlt. Das Biom erfordert eine fortwährende Stabilisierung durch seine «Lunge»: Konstruktionen, die den Luftdruck regulieren und über riesige Kühltürme die überschüssige Wärme ableiten. Es braucht eine gewaltige Infrastruktur, um das System zu beobachten, zu überwachen und zu erhalten und alle Bewohner:innen täglich mit dem Vierfa chen ihres Körpergewichts an Sauerstoff zu versorgen. Dennoch besitzen die Kuppeln einfach nicht die «erhabene Irrationalität, Maßlosigkeit und Absurdität der Natur», bedauert Baudrillard. Bei der Konstruktion scheinen die Dinge vergessen worden zu sein, die Leben schenken. In Wirklichkeit war die Biosphäre nicht einmal jemals vollständig versiegelt, nicht vollkommen isoliert. Von Beginn an versagten ihr Klima und ihre Atmosphäre. Kohlendioxid reicherte sich an, einige Tierarten starben – vor allem Honigbienen, was die Bestäubung der Pflanzen verzögerte. Am Ende musste die Luft «gewaschen» werden, um sie von dem gefährlichen CO₂-Überschuss zu befreien, und es musste Sauerstoff hineingepumpt werden.
Wie üblich verweigerte sich die Luft und verhinderte damit ihre problemlose Unterwerfung und Simulation.
Peter Adey ist Professor für Humangeografie an der Royal Holloway University in London. Er ist der Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Mobilität, Luftfahrt, Kulturgeografie und Politik.