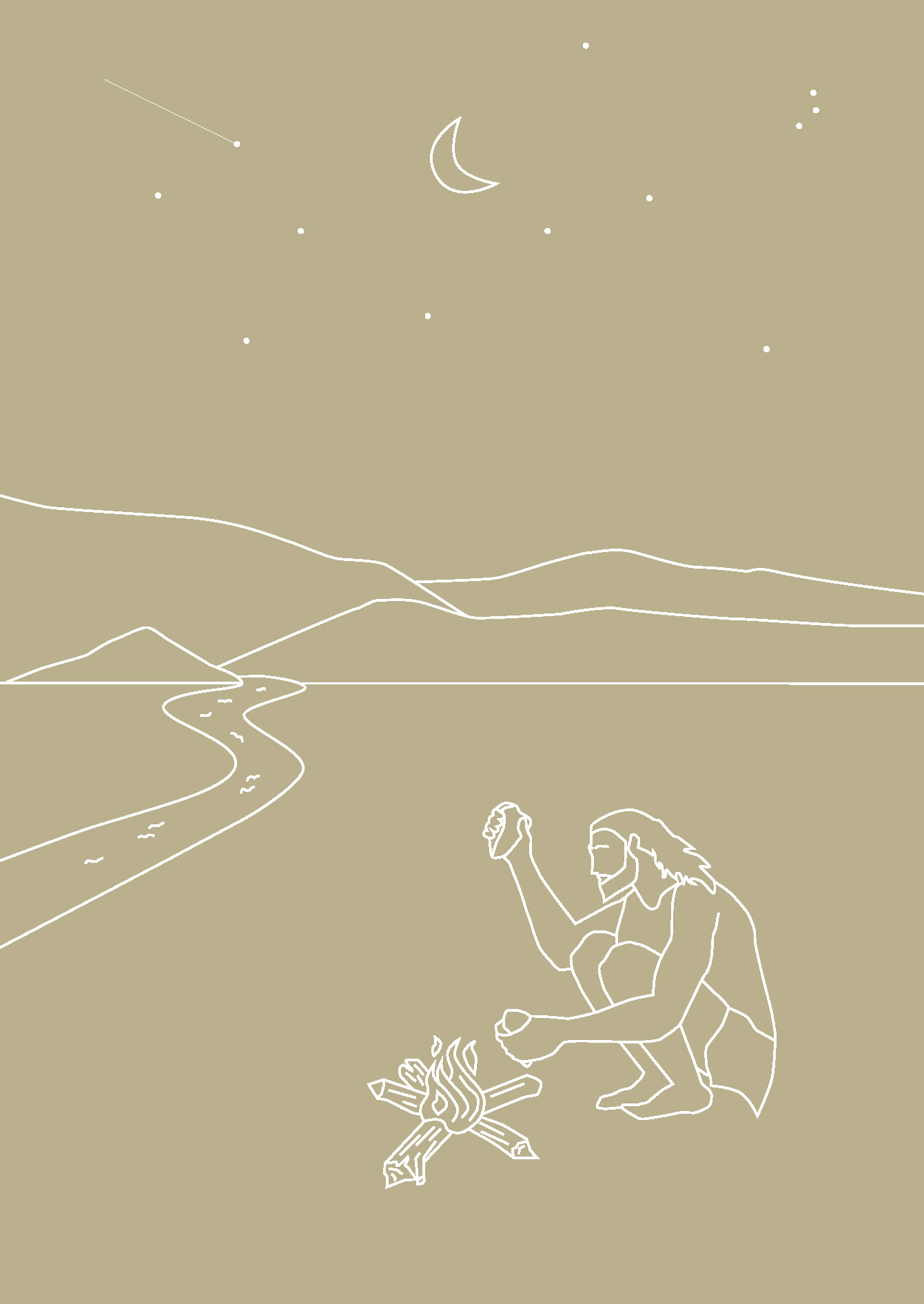Reptilien in der Schweiz: HauptAutor Ulrich Hofer im Interview
Wir haben Ulrich Hofer zu seinem Buch «Reptilien in der Schweiz» befragt. Im Interview hat er uns unter anderem verraten, was man unter der Radiotelemetrie versteht und wie sie eingesetzt wird, welches sein Lieblingsreptil ist und wie man Reptilien in der Wildbahn artgerecht unterstützen kann.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Eintauchen.
Woher kommt Ihre Faszination für Reptilien und wie kam es dazu, dieser Tierklasse ein eigenes Buch zu widmen?
Ich glaube, zur Initialzündung wurden in meiner Kindheit die großformatigen Aufnahmen eines Artikels in der Zeitschrift DU mit dem Titel «Schlangen-Schönheit». Für mich hatten diese arm- und beinlosen Kreaturen etwas Ästhetisches, wohl auch Geheimnisvolles. Im Teenageralter kamen dann die Beobachtungen freilebender Schlangen dazu.
Dass ich ihnen ein eigenes Buch widme, hat mit meiner Vergangenheit als Biologe zu tun. Ich war u.a. während zehn Jahren verantwortlich für das Reptilienschutzprogramm der Schweiz.
Zur Amphibien-Erhaltung gibt es z.B. sogenannte «Fröschli»-Gruppen, die sich jedes Jahr nach Einbruch der Dunkelheit an Hotspots der Kröten- und Froschwanderungen im Frühling treffen und nach möglichen Tieren Ausschau halten, um diese sicher über die Straßen zu bringen. Gibt es sowas ähnliches (Gruppen, Aktionen) auch für Reptilien? Wie kann ich Reptilien aktiv unterstützen?
Es gibt inzwischen in einigen Kantonen Interessengruppen, deren Mitglieder sich in ihrer Freizeit mit der Erforschung und Erhaltung der heimischen Reptilienfauna beschäftigen. Die Gruppen sind offen für alle, denen es nicht um die Terrarienhaltung von Reptilien geht, sondern um den Fortbestand von Schlangen, Echsen und Schildkröten draußen in unserer Landschaft. Sie leisten auch einen wichtigen Beitrag mit der Datenerhebung für Langzeitstudien, mit denen wir die Entwicklung ausgewählter Reptilienbestände überwachen. Und erfreulicherweise nehmen auch immer mehr Natur- und Vogelschutzvereine die Förderung von Reptilien in ihr Tätigkeitsprogramm auf.
Andreas%20Meyer.webp#)
Foto: ©Andreas Meyer
Gäbe es da auch gezielte Projekte oder Aktionen für Schulen?
Mit Schulklassen kann man zum Beispiel an geeigneten Orten Holz-, Stein- oder Komposthaufen anlegen, welche Reptilien als Schlupfwinkel, Eiablageplätze oder zum Sonnenbaden nutzen können.
Was versteht man unter der Radiotelemetrie und wie funktioniert diese?
Die Radiotelemetrie ist eine Methode zur Erfassung der Bewegung von Tieren in der Landschaft. Wir statten sie mit Sendern aus, deren Signal je nach Leistung via Satelliten inklusive Koordinaten empfangen werden kann oder aktiv mit Antenne und Empfänger geortet werden muss. Die Aufzeichnung über Satelliten funktioniert bei uns bisher nur für Schildkröten, die anderen Reptilien sind für die erforderlichen Sender – vorläufig noch – zu klein. Zum Orten von Schlangen oder Echsen stehen wir also nach wie vor mit Antenne und umgehängtem Empfänger im Gelände. Die bisher 11 radiotelemetrischen Studien zu Schweizer Reptilien haben uns aber eine Menge für die Arterhaltung wichtige Erkenntnisse gebracht, die im Buch ausführlich zur Sprache kommen.
Haben Sie ein Lieblingsreptil?
Unter den heimischen Arten klar die Schlingnatter. Ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten mit der kleinsten unserer neun heimischen Schlangenarten. Den Anpassungen auf die Spur zu kommen, mit denen ihre Kleinstpopulationen in unserer Kulturlandschaft überleben, bleibt für mich auch heute noch eine reizvolle Herausforderung.
Andreas%20Meyer.webp#)
Foto: ©Andreas Meyer
Wie kann ich als Laie oder Laiin erkennen, ob es sich bei einer Schlange, um eine Giftschlange handelt? Wie sollte ich mich bei einer Begegnung mit Schlangen grundsätzlich verhalten?
Es gibt zwar eindeutige Merkmale, anhand derer sich in der Schweiz giftige von ungiftigen Schlangen unterscheiden lassen, doch sind die für Lai:innen im Gelände und ohne Behändigung der Schlange kaum zu erkennen. Begegnen wir einer, sollten wir sie ihren Weg gehen bzw. kriechen lassen, denn der führt fast immer weg vom Menschen. Zur Paarungszeit, wenn die Tiere weniger aufmerksam sind, kriecht vielleicht mal eine Schlange näher als nötig an uns vorbei, doch selbst dann gilt: Einfach ziehen lassen. Praktisch alle Bissunfälle ereignen sich, weil das Opfer versucht, die Schlange zu behändigen oder sonst wie zu behelligen.
Reptilien gelten im Allgemeinen als äußerst robuste Tiere. Trotzdem werden bestimmte Reptilienarten (in der Schweiz) als gefährdet eingestuft. Welche sind das und was sind Gründe dafür?
Tatsächlich sind Reptilien robuster, beweglicher und anpassungsfähiger, als wir lange vermutet hatten. Das hilft ihnen aber nicht gegen den Verlust ihrer Lebensräume und die Verknappung lebenswichtiger Ressourcen, vor allem von Beutetieren, aber auch von Schlupfwinkeln, Eiablageplätzen und frostsicheren Überwinterungsstätten.
Als gefährdet gelten nach wie vor 13 der 16 Arten, nämlich alle außer der Westlichen Blindschleiche, der Mauer- und der Bergeidechse. Modellrechnungen deuten aber darauf hin, dass eine Mehrheit von der Klimaerwärmung profitieren dürfte und sich allmählich Lebensräume erschließt, deren Lokalklima für eine Besiedlung bisher schlicht zu kühl war. Da auch vielerorts die Erhaltungsmaßnahmen für Reptilien zu greifen beginnen, kann es also durchaus sein, dass einige Arten in absehbarer Zeit nicht mehr auf der Roten Liste stehen.
Manfred%20Eichele.webp#)
Foto: ©Manfred Eichele
Eidechsen, die sich z.B. in Gärten auf warmen Steinen sonnen, sind wohl die Reptilien, die man am häufigsten im Alltag zu Gesicht bekommt. Wie und wo kann ich in der Schweiz in der freien Wildbahn sonst noch andere Reptilienarten entdecken und beobachten?
Im Mittelland begegnen wir an naturnahen Gewässerufern vielleicht mal einer Ringelnatter, und Mauereidechsen finden sich an Straßen- und Wegböschungen, auf Industriearealen und im Siedlungsraum. Auf einer Bergwanderung sehen wir am ehesten eine Giftschlange, in den Westalpen, im Wallis und im Jura üblicherweise eine Aspisviper, östlich des Sustenpasses eine Kreuzotter. Und beim Rustico im Tessin kommt vielleicht gelegentlich eine Äskulap- oder eine Zornnatter vorbei, beide sind völlig harmlos.
Welche Botschaft(en) möchten Sie mit ihrem Buch vermitteln?
Ich möchte an Natur interessierten Leserinnen und Lesern die Erkenntnisse aus der Reptilienforschung in der Schweiz in allgemein verständlicher und, so hoffe ich, kurzweiliger Form zugänglich machen und mehr Nähe zu «unseren» Schlangen, Echsen und Schildkröten schaffen. Dazu gehört auch, aufzuzeigen, mit welchen Arbeitsmethoden, technischen Hilfsmitteln und in welcher Rolle – als Forscherin oder Laie, beruflich oder in der Freizeit – sich Menschen bei uns mit Reptilien beschäftigen. Mich freut, wenn mein Buch dazu beiträgt, dass sich bei uns auch die nachrückende Generation für die Erhaltung unserer Reptilienfauna einsetzt.
Und zum Schluss: Haben Sie ein besonderes Erlebnis in Verbindung mit Reptilien, das Sie geprägt hat und das Sie hier mit uns teilen möchten?
Ein besonderes Erlebnis könnte ich nicht abrufen, doch sehe ich Reptilien aus dem Ei schlüpfen oder ein Reptilienweibchen beim Gebären – im Bewusstsein, dass die Kleinen vom ersten Tag an auf sich selbst gestellt sind –, dann ist das schon ein berührender Moment.
Andreas%20Meyer.webp#)
Foto: ©Andreas Meyer
Ulrich oder Ueli Hofer war als Co-Leiter der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz während 10 Jahren verantwortlich für das Reptilienschutzprogramm der Schweiz und Hauptautor des ersten Reptilienatlas’ der Schweiz. Später arbeitete er als Mitgründer und Mitinhaber einer Dienstleistungsfirma 20 Jahre in der Medizintechnikindustrie, vor allem im klinischen Bereich. Daneben wirkte er als Dozent an der ETHZ und den Universitäten Bern und Basel.